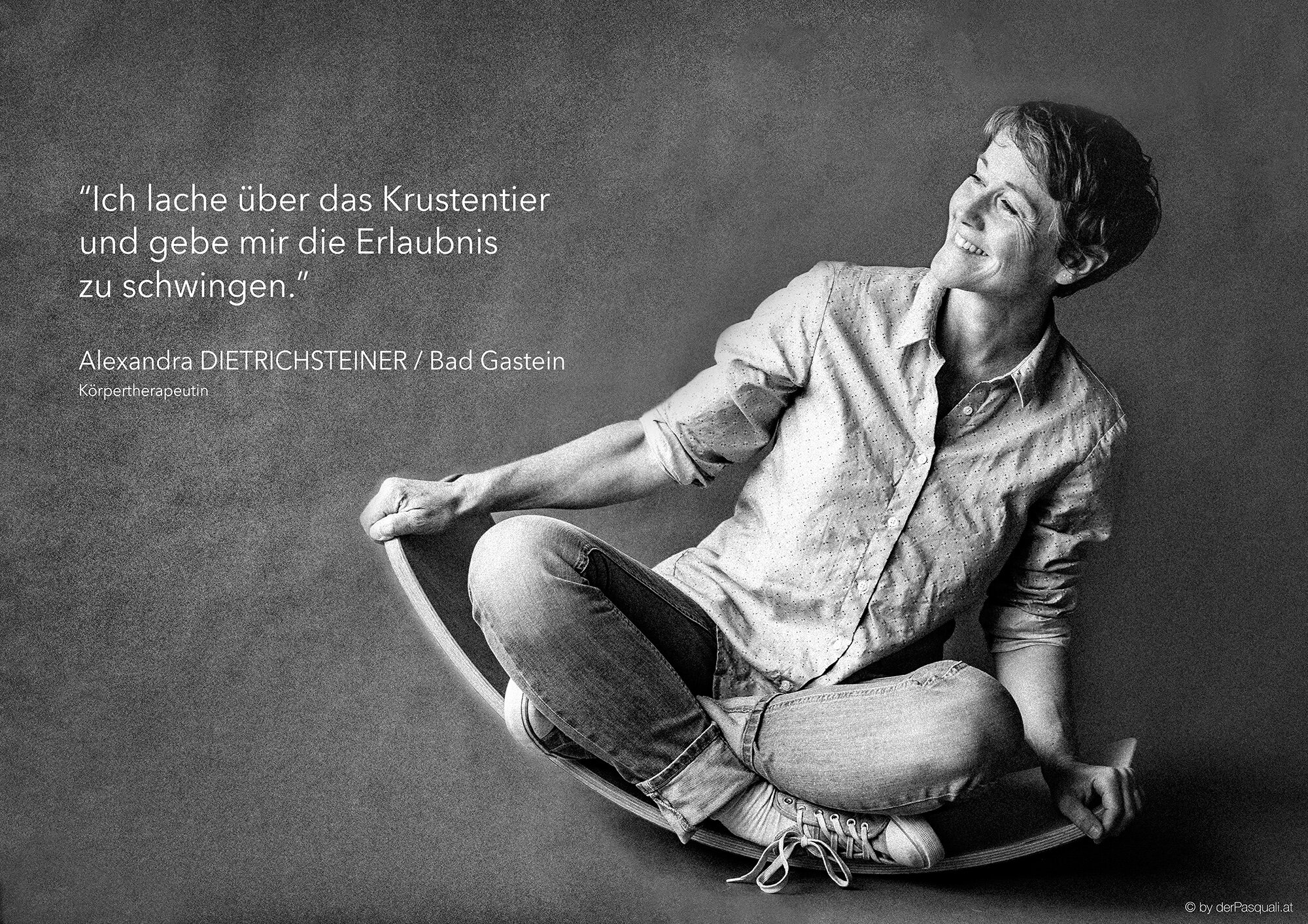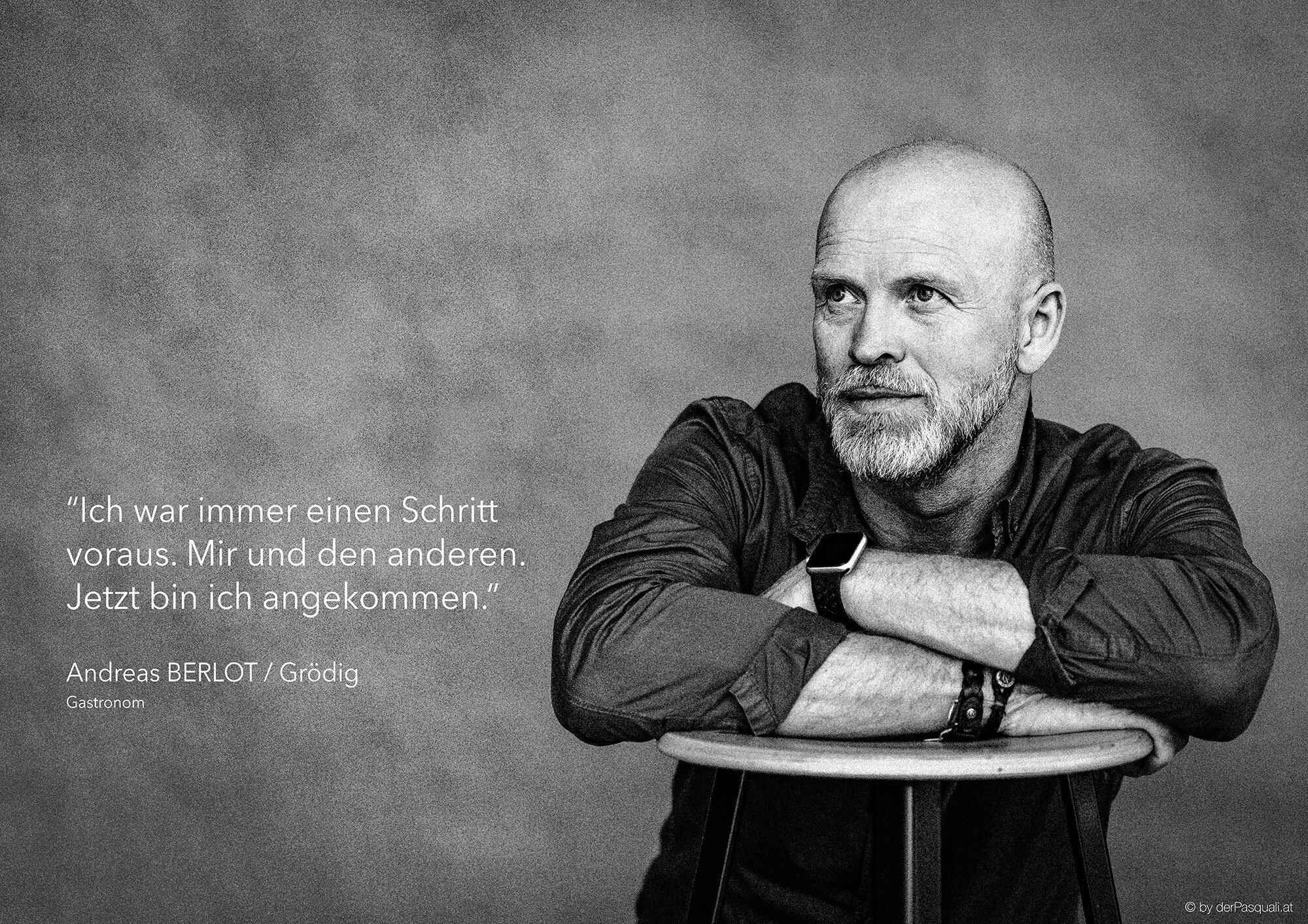DIE Titelgeschichte im letzten “FALTER”, die es nicht gibt, erinnert mich daran, wie die Zeit vergeht. Der Sommer 2015, als alles begann, ist schon fünf Jahre her. Der FALTER bringt ein paar um Ausgewogenheit bemühte Zahlen und will wissen, was aus den „Gutmenschen“ von damals geworden ist, die aus der Zivilgesellschaft kamen und maßgeblich dafür verantwortlich waren, dass die Flüchtlingswelle bewältigt werden konnte. Ein bisschen halbherzig, finde ich, für einen Untertitel, der großes ankündigt: „Wie der Flüchtlingssommer vor fünf Jahren Österreich veränderte“. Die GESCHICHTE dazu verlor sich offenbar in den druckfahnen.
Ich weiß schon, das Wort „Flüchtlingswelle“ sollte man nicht verwenden, genauso wie „Flüchtlingsstrom“ oder gar „Flüchtlingsflut“, weil das ja negative Konnotationen und vor allem – was in diesem Zusammenhang immer wieder betont wird – negative Lösungsansätze wie Dammbau, Befestigungen oder Wellenbrecher evoziert. Aber es war halt nun einmal ein plötzliches historisches Ereignis, das über uns hereingebrochen ist (für die Politik war die Entwicklung übrigens vorhersehbar, nachdem 2014 die Gelder der UN für die Lager im Libanon und in Jordanien drastisch gekürzt worden sind) und sich nicht langsam ankündigte. Ein Ereignis, für das metaphorische Bezüge wie Flut und Welle besser passen als politisch zwar korrekte, aber schwammige Begriffe wie „Fluchtbewegung“ oder „Migration“. Die nicht weniger problematisch sind: Denn wo hört Migration auf und wo beginnt Flucht?
Dazu noch einmal die Zahlen: 2015 waren weltweit zirka 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Davon elf Millionen Menschen aus Syrien. Vier Millionen von Ihnen suchten außerhalb ihres Landes Schutz. Davon kamen wiederum knapp eine Million nach Österreich (90.000) bzw. Deutschland (890.000). Doch Vorsicht! Die Zahl 90.000 bezieht sich auf die Asylanträge. Tatsächlich Asyl in Österreich erhielten in den letzten 5 Jahren zirka 70.000 Menschen aus Syrien, Afghanistan, Irak oder dem Iran. Das ist nicht einmal ein Prozent der Bevölkerung. Oder einer von 125 Menschen in einem Kinosaal.
2015: Szene 1
Salzburger Hauptbahnhof. September 2015. Ich bin zufällig hier und sehe einen Zug einfahren. Der Bahnsteig ist überfüllt mit Menschen. Es ist ein Flüchtlingszug. Als die ersten Flüchtlinge aussteigen, wird geklatscht. Auf den Transparenten steht „Flüchtlinge Willkommen“ und die Menschen beklatschen die aus zögernd aus dem Zug Steigenden. Mein erster Impuls: „Das kann nicht gut gehen. Das ist nicht angemessen.“ Für mich hatte es etwas von einem surrealen Theaterstück als ich versuchte, mich in die Menschen hineinzufühlen, die hier am Bahnsteig gestrandet waren. Geflüchtet, vertrieben aus ihrer Heimat, aus einem Kriegsgebiet mit oft nur einem Sackerl in der Hand, stehen sie da und können nicht einordnen, was hier gerade abläuft. Applaus. Wohlgemerkt: Das war damals nicht nur blauäugig. Das war auch zu verstehen als klare Kampfansage im politischen Diskurs – gegen die, die glauben, das Problem wäre lösbar, indem man die Festung Europa dicht macht. Das ging damals nicht und das geht auch heute nur auf Kosten derer, die unsere Hilfe brauchen.
2015: Szene 2
Wenige Wochen später im November 2015. An der Grenze zu Freilassing. Es ist 3 Uhr früh. Ich bin am Grenzübergang Freilassing. Im letzten Zelt, bevor es über die Brücke nach Deutschland geht. Draußen ist es noch dunkel. Kalt. Alle halbe Stunde verlassen 30 Menschen dieses Zelt und 30 neue kommen. Meine offizielle Aufgabe hier ist es, für einen geordneten Ablauf zu sorgen. Wir haben eine Kinderecke eingerichtet, mit Decken und ein paar Spielsachen. Die Erwachsenen danken es uns mit Blicken. Viel wird nicht geredet. Was wir geben, ist Augenhöhe. Respekt. Verständnis. Ein Lächeln hier. Eine kleine Geste dort. In dieser Nacht durchschneide ich bei zirka 500 Menschen das Armband und öffne das Zauntor, damit sie über die Brücke gehen. Schüttle Hände – sage „Good Luck“ wie ich es noch nie gesagt habe. Ein kleines Mädchen, dem ich zuvor ein Blatt Papier und Stifte reichte, dreht sich um und läuft noch einmal zurück. Zu mir. Steckt mir ein Bild zu, das sie im Zelt gezeichnet hat und lächelt. Ich sehe nur Wasser und Menschen. Im Wasser. Ohne Boot. Rechts oben ein Sonnenfleck. Ich bin bestürzt. Umarme sie. Danke! Was werden wir unseren Kindern erzählen? Was machen wir hier? Was wir tun können, ist begrenzt. Aber es gibt Kraft, als freiwilliger Helfer Teil von einer Zivilgesellschaft zu sein, die menschlich handelnd vorangeht.
Im Herbst 2015 hatte man kurze Zeit das Gefühl, dass das Schüren von Ressentiments gegenüber Schutzsuchenden in diesem Land nicht mehrheitsfähig ist. Das hat sich geändert. Grundlegend. Bald schon wurden Obergrenzen eingeführt und hässliche Bilder bewusst in Kauf genommen. Über die Köpfe der Geflohenen und Schutzsuchenden hinweg. Im Namen eines grausamen Spiels, das ich geostrategisches Domino nenne. Wo Domino gespielt wird, gibt es einen ersten Stein. Und eine lange Schlange aus Steinen. Und irgendwo am Ende der Schlange da erwischt es Menschen. Da werden Menschen begraben und Hoffnungen. Doch es war kein Spiel, das an der mazedonischen Grenze in Idomeni gespielt wurde. Das war reales Tränengas. Das war reale Gewalt.
2015: Szene 3
Weiter nach Lesbos. Zu den Bergen von Schwimmwesten, die sich an der Küste türmen. Zu den Fischern, die seit Juli 2015 beinahe täglich tote Menschen aus dem Meer ziehen; und wenn sie Menschen in Seenot helfen womöglich der Schlepperei bezichtigt werden. Hier an den Rändern zeigt Europa sein wahres Gesicht. Hier konnte man sie sehen, die Dominoeffekte, mit denen Spin-Doktoren die politische Debatte gestalten, ohne an Lösungen interessiert zu sein.
Frauen, Männer, Kinder. So viele Kinder. Traumatisiert. Verzweifelt. Tot. Unerträgliche Bilder, die sich eingebrannt haben, wie das des 3-jährigen toten Jungen am türkischen Strand. Mit rotem T-Shirt und kurzer blauer Hose. Das Gesicht im Sand vergraben. Sein Name war Alan Kurdi. Ich muss ihn hier sagen. Es ist schwer hinzuschauen. Aber wohin sollen wir schauen? Überall werden sie angespült. Menschen, die alles zurückgelassen haben. Hals über Kopf geflohen sind, auf der Suche nach dem Silberstreif am Horizont, der sich Hoffnung nennt. Noch immer.
fairMATCHING – eine Idee, die zündet
Wenn ich über die Anfänge von fairMATCHING schreibe, muss ich auch darüber schreiben. Ich kann und will diese Bilder und die Geschichten, die sie erzählen, nicht vergessen. Flucht beginnt dort, wo Menschen fliehen. Hals über Kopf. In der Nacht, weil sie um ihr Leben fürchten; weil sie verfolgt werden; weil es kein Wasser mehr gibt, das sie trinken können; weil sie Kinder haben, die seit Monaten keine Schule mehr besuchen konnten; weil Existenzen auseinanderbrechen und die Hoffnung verschwunden ist. Die Situation war extrem damals. Extrem aufgeladen. Und wir? Wir wollten was tun!
Und wir tun noch immer: Seit 2016 begleiten wir Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund individuell und auf Augenhöhe auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt. Weil wir davon überzeugt sind, dass Arbeit ein Motor sein kann, um sich in einem neuen Land zurechtzufinden und ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Als wir Ende 2015 mit unserem Ansatz ins kalte Wasser sprangen, gab es überall Flüchtlingsheime und unsere Arbeit bestand zum großen Teil im Sondieren der Situation. Unter den Geflüchteten von damals finden sich heute Menschen und Freunde, die in Österreich Karriere gemacht haben, was zeigt, dass Integration langsam in die Tiefe geht. Die UNHCR verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff „Naturalization“ als Maßstab für gelungene lokale Integration. Ende Dezember 2018 beschließt sie in diesem Zusammenhang einen New Deal, den sie Global Compact on Refugees nennt, mit der „Stärkung der Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der geflüchteten Menschen“ als einen von 4 Eckpfeilern. Es hat sich viel getan, hierzulande. Und trotzdem: das Sterben an den Grenzen von Europa hat nie aufgehört, auch wenn es aus den Medien verschwunden ist.
Auch wir haben damit leben gelernt. Wir reden nicht darüber, was an den Rändern von Europa passiert oder was am Balkan gerade abläuft. Wir reden nicht von der unzumutbaren Situation Tausender Kinder auf Lesbos oder Chios. Wer reden nicht mehr über den Krieg in Syrien. Oder das Regime in Afghanistan. Wir echauffieren uns nicht mehr darüber, dass Österreich es nicht schafft, in Zeiten von #corona ein Zeichen zu setzen und wie Deutschland und andere halbwegs zivilisierte Länder ein paar Kinder aus den total überfüllten Flüchtlingslagern aufzunehmen. Wir haben uns damit abgefunden, dass wir nach außen hin nicht menschlich handeln, weil das unser Land für Menschen, die sich auf der Flucht befinden, attraktiv machen würde. Und wir leiden. Wir leiden unter dieser unerträglichen, von oben aufgezwungenen Logik genannten Schizophrenie wie die Hunde. Weil wir insgeheim wissen, dass damit unsere Loyalität zu einem Land, das wir lieben, auf dem Spiel steht. Und weil wir wissen, dass “die hermetische Schließung der Südgrenze Europas durch die EU eine Liquidierung des Asylrechts ist und damit ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit”, wie Jean Ziegler es auf den Punkt bringt.
Aber zurück zu fairMATCHING. Und dorthin, wo wir Dinge in die Hand nehmen und gestalten können. Wir sind seit 2018 Partner des AMS, weil wir bewiesen haben, dass individuelle Begleitung auch in Zahlen messbaren Erfolg bringt. Und zwar nachhaltigen. Und weil wir jeden Tag aufs Neue versuchen, unser Angebot anzupassen. Zu adaptieren. Zu optimieren. Wir sind erfolgreich, weil wir uns nie hinter Maßnahmen verstecken, sondern immer den Dialog suchen. Vorbehaltlos. Wir sind erfolgreich, weil wir über den Tellerrand schauen, das heißt, auch das sehen, was nicht unmittelbar mit unserer Kernaufgabe zu tun hat. Weil wir Menschen nicht auf einen Aspekt reduzieren, sondern versuchen, sie in ihren Bedürfnissen ganzheitlich ernst nehmen. Das schafft jene Beziehungsqualität, wo das Miteinander gedeiht.
Outside-the-Box
Dieses Denken „Outside the box“ war und ist auch die Vision von fairMATCHING –, weil es uns von Anfang an nicht nur um Arbeitsvermittlung ging, sondern um das dynamische Verhältnis von Arbeit UND Integration, wie es unsere Tagline „Arbeit als Motor für Integration“ nahelegt. Arbeit kann Integrationsmotor sein, muss es aber nicht. Arbeit kann bestehende Schwierigkeiten auch zuspitzen, Isolation verschärfen, wenn Vorurteile das Sagen haben oder/und es keinen Raum gibt, in dem man/frau wachsen kann. Genauso wie Familie Schutz sein kann und Rückzugsort, aber auch Gefängnis, wenn Frauen mit Fluchthintergrund sich entschließen, ihren eigenen Weg zu gehen und kulturelle Festschreibungen dabei mitunter den Atem nehmen.
Vor diesem Hintergrund haben wir Arbeitsvermittlung niemals als isoliertes Ziel gedacht, sondern immer auch auf das Rundherum geschaut und darauf, wie diese Arbeit sich für den Einzelnen anfühlt; was durch Arbeit passiert; ob sie beflügelt oder niederhält; ob sie isoliert; ob sie Erfahrungen zementiert oder neue Möglichkeitsräume öffnet; ob sie Menschen festschreibt auf einen Status Quo oder ob sie die Potenziale sieht, die brach liegen, und diese entwickelt.
Unser richtungweisendes EU-Projekt FRAUEN MUT MACHEN, das wir 2018 und 2019 durchführten, war in dieser Hinsicht genauso wichtig, wie das unsere Arbeit flankierende Erzählprojekt VON WO ICH MICH SEHE oder unsere zahlreichen, etwas profaneren JOB-SPEED-DATING-Events.
Unser Denken „Outside the box“ brachte es auch mit sich, dass wir im letzten Jahr – angeregt durch die Berührung mit europäischen Grass-Roots-Projekten – das für uns Zusammengehörende – Arbeit UND Integration – in einem neuen Anlauf trennten und als Replik auf die reale Situation provokativ zuspitzten: „Arbeit und?...“ versucht in aller Entschiedenheit die Frage zu beantworten, was „Arbeit“ dem Einzelnen in seiner konkreten Situation bringt und was „trotz Arbeit“ im Sinne eines guten Zusammenlebens zu tun bleibt.
Konkret stellten wir uns ganz entschieden die Frage, wie die Kluft, die sich immer wieder zwischen der Vermittlung von Arbeit und der Entwicklung in Richtung aktiver und vollwertiger Bürgerschaft auftut, nachhaltig zu schließen ist. Denn das ist der wunde Punkt, der uns auch nach fünf Jahren noch zu schaffen macht: Dass geflüchtete Menschen hierzulande zwar allerhand Zuwendungen erfahren, jedoch dort, wo sie nicht mehr empfangen, sondern in die Gestaltung gehen wollen, die gläserne Decke spüren, die sie an der selbstbestimmten Verfolgung ihres Wegs hindert.
Unsere Antwort darauf heißt “matchBOX”
Ein Raum, in dem wir nicht nur miteinander reden, sondern auch miteinander tun.
Ein Raum, in dem wir unsere Kernkompetenzen der Arbeitsvermittlung reflektieren und ausbauen können. Und gleichzeitig ein Raum, in dem wir über den Tellerrand schauen und aus der Praxis heraus entscheidende Mosaiksteine für ein gelungenes Zusammenleben mitgestalten können. Arbeit und! …
Ein SOCIAL HUB, der als Inkubator oder Brutkasten für das Land Salzburg fungiert, indem soziale Innovation sich niederschwellig erproben kann. Ein zugleich dialogischer und experimenteller Raum, der ergebnisoffen, niederschwellig zugänglich und brückenschlagend ist. Ein Raum, in dem neue Formate entwickelt und durchgespielt werden können. Und ein Raum, der natürlich nur extrem partizipativ funktionieren kann, wenn NEWCOMER oder NEUANKÖMMLINGE als aktive Gestalter ernst genommen und in ihrer Selbständigkeit gefördert werden sollen. Gleichzeitig aber auch ein Raum, der die Schnittstelle bildet zu ganz konkreten Anforderungen des Arbeitsmarktes.
Ein Raum, der auf folgenden 4 Säulen errichtet werden soll:
1) Participation & Empowerment – die matchBOX als co-kreatives, dialogisches Projekt, das NEWCOMER von Anfang aktiv mitgestalten.
2) Social Innovation – die matchBOX als Ort, wo niederschwelliges Miteinander-Lernen, Erfahren, Erproben und Experimentieren möglich ist.
3) Open Space – die matchBOX als offener Raum für neue Formate, Ideen, Menschen und Aktivitäten.
4) Information & Guidance – die matchBOX als Informationsdrehscheibe und Ort der Arbeitsvermittlung, Beratung, Begleitung, Führung (Guidance), der auch von anderen Stakeholdern genutzt werden kann.
Dieser Text ist auch ein Aufruf. Macht mit! Meldet euch! Teilt die Kunde. Es ist Zeit, dass wir noch viel entschiedener die Welt und unser Salzburg miteinander gestalten.
Wir freuen uns auf jede Stimme!
Wolfgang Tonninger